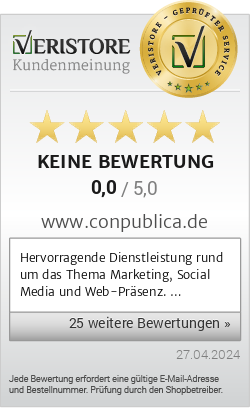Schlagwortarchiv für: Deutsch
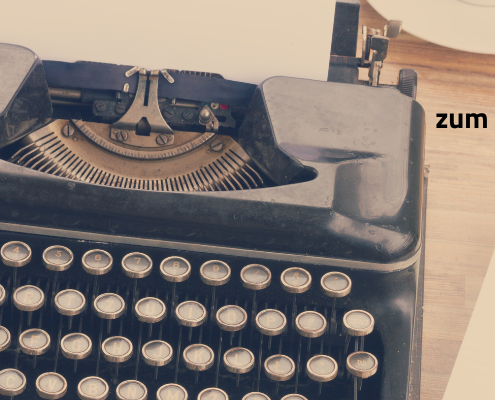
Mit ein paar Tipps zum perfekten Schreibstil
Content, Sprache, TexttippMaßgeblich für den Erfolg eines Textes ist, neben seinem Inhalt und seiner Verbreitungsform, die Art des Schreibstils. Für alle, die sich beim Formulieren schwertun, kommen hier Tipps, um Euren Schreibstil zu verbessern.

Deutsche Sprache – schwere Sprache: Wie man mit Grammatikregeln Ordnung in die ganze Sache bringt
Content, Sprache, TexttippSprache ist etwas Herrliches. Durch sie eröffnen sich für uns Menschen neue Welten. Im übertragenen und echten Sinne. Denn ohne die Sprache zu verstehen, können wir sehr hilf- und orientierungslos durch ein Land gehen. Allerdings kann Sprache auch viel zerstören: Unüberlegte oder falsche Worte können manchmal größeren Schaden anrichten als es Taten können. Daher sind Regeln und die korrekte Wortwahl ein machtvolles Werkzeug in der Zwischenmenschlichen Kommunikation. Wir zeigen dir die wichtigsten Regeln der deutschen Sprache.

Anglizismen im Deutschen – so geht‘s
Sprache, TexttippFremdworte fuschen sich mittlerweile in unsere tägliche Sprache, ohne dass wir es bemerken. Und dabei werden sie gar nicht mehr ausschließlich von Jugendlichen verwendet, denn dank oder wegen der modernen Medien und der immer digitaleren Welt sind „denglische“ Begriffe in aller Munde. Wie wir in der deutschen Sprache korrekt mit (d)englischen Begriffen umgehen, erläutert dieser Blogartikel.

Deutsch ist nicht gleich Deutsch
PR-TIPPS, Sprache, TexttippWo unsere Ländergrenzen verlaufen, das wissen wir. Dabei vergessen wir jedoch oft, dass die deutsche Sprache nicht auf diese Grenzen beschränkt ist. Auch in Österreich und der Schweiz spricht man Deutsch. Verstehen können wir trotzdem noch lange nicht alles. Das liegt nicht nur am gesprochenen Akzent, sondern an den sogenannten Austriazismen und Helvetismen, typisch österreichisch und schweizerisch geprägten Redewendungen oder Arten der Verwendung von Worten, sprachlichen Besonderheiten aus unseren Nachbarländern.