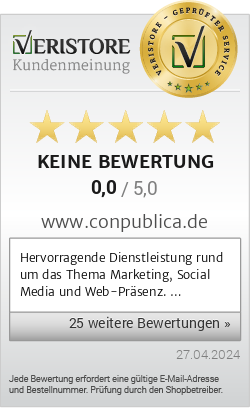Schlagwortarchiv für: Rechtschreibung
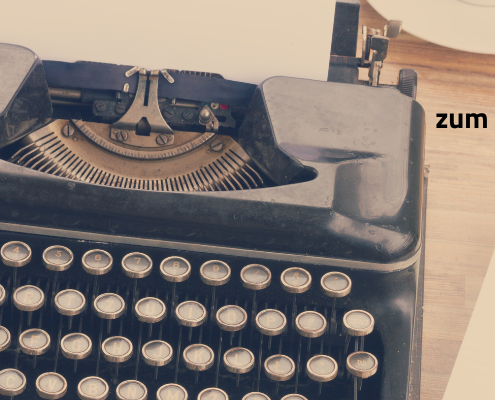
Mit ein paar Tipps zum perfekten Schreibstil
Content, Sprache, TexttippMaßgeblich für den Erfolg eines Textes ist, neben seinem Inhalt und seiner Verbreitungsform, die Art des Schreibstils. Für alle, die sich beim Formulieren schwertun, kommen hier Tipps, um Euren Schreibstil zu verbessern.

Deutsche Sprache – schwere Sprache: Wie man mit Grammatikregeln Ordnung in die ganze Sache bringt
Content, Sprache, TexttippSprache ist etwas Herrliches. Durch sie eröffnen sich für uns Menschen neue Welten. Im übertragenen und echten Sinne. Denn ohne die Sprache zu verstehen, können wir sehr hilf- und orientierungslos durch ein Land gehen. Allerdings kann Sprache auch viel zerstören: Unüberlegte oder falsche Worte können manchmal größeren Schaden anrichten als es Taten können. Daher sind Regeln und die korrekte Wortwahl ein machtvolles Werkzeug in der Zwischenmenschlichen Kommunikation. Wir zeigen dir die wichtigsten Regeln der deutschen Sprache.

Die richtige Anrede für deine Webseite: Der ultimative Quick-Check
Content, Sprache, TexttippTexte für Webseiten zu schreiben ist eine unserer Hauptaufgaben. Eine Frage stellt sich dabei immer ganz zu Anfang: Soll auf der Webseite geduzt oder gesiezt werden? Wie man Kunden richtig anspricht, ist dabei eigentlich ganz leicht herauszufinden. Wir haben den ultimativen Quick-Check für euch!

Falsche Schreibweise – Richtige Schreibweise
Content, Sprache, TexttippWer uns auf den sozialen Medien folgt, hat sicherlich bereits bemerkt, dass wir seit einiger Zeit die typischen falschen Schreibweisen von Wörtern aufzeigen. Die deutsche Rechtschreibung hat es nämlich in sich und viele von uns schreiben täglich unwissentlich Worte falsch. Wir erklären dir, warum viele Menschen die Worte falsch schreiben und zeigen dir typische Beispiele.
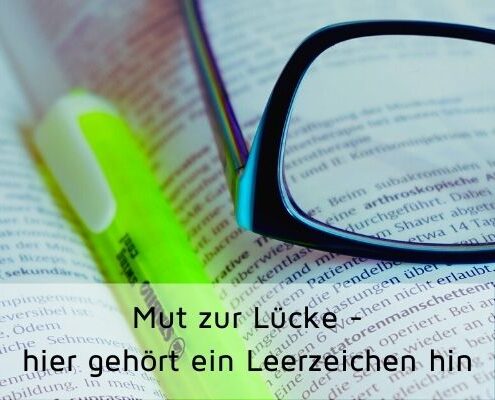
Mut zur Lücke – hier gehört ein Leerzeichen hin
Sprache, TexttippManchmal ist ein Leerzeichen wirklich zu viel – bei Deppenleerzeichen zum Beispiel, die zwischen selbst erfundenen Wortschöpfungen stehen und eigentlich ein Bindestrich sein sollten. Aber manchmal müssen sie orthografisch sein. Oft gerade da, wo viele von uns sie nicht vermuten. Wir haben ein paar Regeln für euch zusammengestellt.

Ein ‚s‘ oder zwei? Kleine Auffrischung zu den gängigsten Rechtschreibfehlern
Sprache, TexttippMit den Rechtschreib- und Grammatikregeln der deutschen Sprache lassen sich ganze Bücher füllen. Pünktlich zum Wochenende gibt es heute eine kleine Zusammenstellung an Fehlern, die mir in letzter Zeit immer mal wieder aufgefallen oder selbst unterlaufen sind.

Die wichtige Bedeutung der Groß-Kleinschreibung
Sprache, TexttippEs gibt einige Regeln der deutschen Rechtschreibung, über die man sicher streiten kann. Eine Regel oder vielmehr ein Regelbereich jedoch ist essentiell wichtig für das Verständnis der geschriebenen Sprache: Die Groß-Kleinschreibung. Auch wenn hier der eine oder andere denkt, warum man unbedingt Substantive groß schreiben muss, während Verben immer klein geschrieben werden (außer am Satzanfang), dem seien diese Beispiele eine Lehre.

Duden Korrektor und Duden Mentor – kleine Helferlein für Autoren
Allgemein, PR-TIPPS, Sprache, TexttippRechtschreibfehler sind ein Makel für jeden Text. Neben den Rechtschreibprüfungen an Bord gibt es einige Lösungen von Drittanbietern wie vom Duden-Verlag (Duden Mentor) oder von EPC. Letztere haben vor einigen Jahren den Duden Korrektor übernommen und weiterentwickelt. Wir haben beide Lösungen getestet und geben eine Empfehlung.

Beliebte Fehler der deutschen Sprache
Sprache, TexttippDie deutsche Rechtschreibung hat es in sich – viele von uns schreiben täglich unwissentlich Dinge falsch. Wir werfen mal einen Blick auf die Standardfehler (nicht StandarT) und zeigen dir, was so abgeht in der deutschen Sprache.