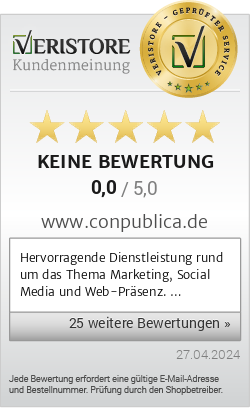Schlagwortarchiv für: Sprache

10 Tipps für verständliche Unternehmens-Kommunikation
PR-Branche, Sprache, Strategie, Texttipp„Wir können nicht nicht kommunizieren.“ Das hat Paul Watzlawick so schlau in den 60er- Jahren bemerkt. Zwar war damit auch die Körpersprache gemeint, aber für Unternehmen gilt dieser Grundsatz ganz genauso. Jegliche Aktion – sei es…
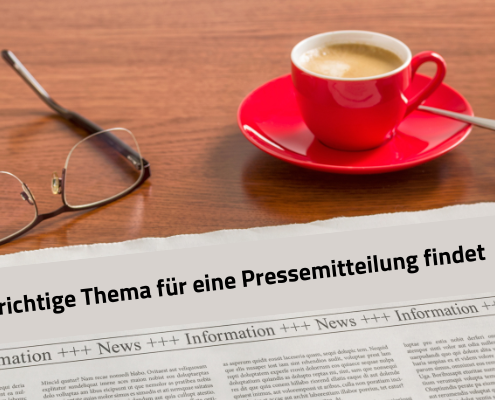
Wie man das richtige Thema für eine Pressemitteilung findet
PR-Branche, PR-TIPPS, Social Media, SpracheEine Pressemitteilung informiert die Öffentlichkeit über Neuigkeiten, Produkte eines Unternehmens. Wir geben Tipps für die Themenauswahl.

Wenn schon in der Unternehmenskommunikation gendern, dann richtig
Journalisten, News, PR-Branche, SpracheGendergerechte Sprache – kaum ein Sprachthema führte zu so viel Diskussionen wie das „gendern“. Die einen sagen: Ein Muss. Die anderen sagen: Völliger Quatsch. Dazwischen gibt ganz viele verschiedene Meinungen und auch Möglichkeiten, alle Geschlechter und Identitäten gleichermaßen in unsere Sprache einzubeziehen- also Formulierungen zu benutzen, die alle sichtbar und hörbar machen.
Natürlich geht die Diskussion weder an den Medien noch an den Unternehmen in ihrer Unternehmenskommunikation vorbei. Wir schauen uns dies näher an.

Achtung! So erstickst Du Deinen Text mit Adjektiven
Sprache, TexttippWir alle wollen interessante Texte. Welche, die gelesen werden. Darum neigen wir manchmal dazu, insbesondere Werbetexte mit einem Zuviel an „Wie“ zu überfrachten – wir ersticken ihn mit Adjektiven. Wie Du diesen Fehler vermeidest und Deinen Text trotzdem lesenswert machst, erfährst Du hier.
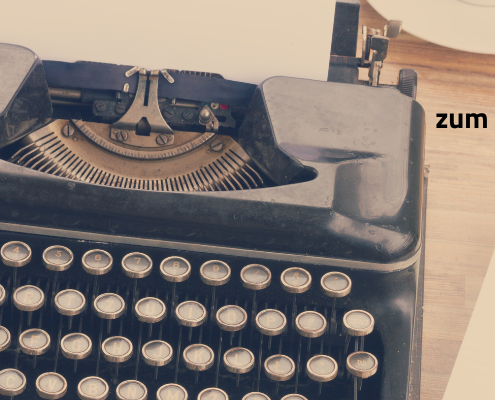
Mit ein paar Tipps zum perfekten Schreibstil
Content, Sprache, TexttippMaßgeblich für den Erfolg eines Textes ist, neben seinem Inhalt und seiner Verbreitungsform, die Art des Schreibstils. Für alle, die sich beim Formulieren schwertun, kommen hier Tipps, um Euren Schreibstil zu verbessern.

Deutsche Sprache – schwere Sprache: Wie man mit Grammatikregeln Ordnung in die ganze Sache bringt
Content, Sprache, TexttippSprache ist etwas Herrliches. Durch sie eröffnen sich für uns Menschen neue Welten. Im übertragenen und echten Sinne. Denn ohne die Sprache zu verstehen, können wir sehr hilf- und orientierungslos durch ein Land gehen. Allerdings kann Sprache auch viel zerstören: Unüberlegte oder falsche Worte können manchmal größeren Schaden anrichten als es Taten können. Daher sind Regeln und die korrekte Wortwahl ein machtvolles Werkzeug in der Zwischenmenschlichen Kommunikation. Wir zeigen dir die wichtigsten Regeln der deutschen Sprache.

Wo geht die Reise hin? Die Zukunft der Sprache
Kreativität, PR-TIPPS, Sprache, TexttippSprache kann einen und trennen. Die gleiche zu beherrschen ist eine Grundvoraussetzung für gelungene Kommunikation. Vielleicht ist das bald leichter, als wir denken. Denn zum ersten Mal rückt der Gedanke einer Universalsprache in den Bereich des Denkbaren. Oder wird es eher ein Social Mischmasch bzw. eine riesige Gruppe einzelner Slangs? Wir gehen das Sache nach.
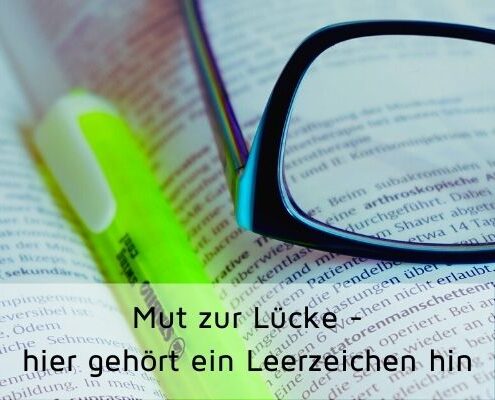
Mut zur Lücke – hier gehört ein Leerzeichen hin
Sprache, TexttippManchmal ist ein Leerzeichen wirklich zu viel – bei Deppenleerzeichen zum Beispiel, die zwischen selbst erfundenen Wortschöpfungen stehen und eigentlich ein Bindestrich sein sollten. Aber manchmal müssen sie orthografisch sein. Oft gerade da, wo viele von uns sie nicht vermuten. Wir haben ein paar Regeln für euch zusammengestellt.
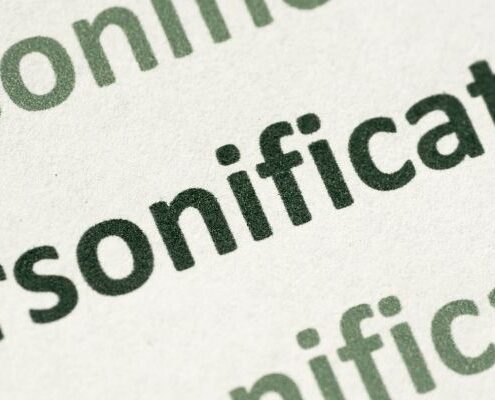
Vertraute Bilder – wie Personifikationen deinen Text zum Leben erwecken
Kreativität, Sprache, TexttippWer in der Schule mal Lyrik analysieren musste, kennt sie vielleicht noch: die Personifikation. Die „Vermenschlichung“ von Gegenständen, Tieren oder Pflanzen wird dort als Stilmittel häufig eingesetzt. Aber wusstest du auch, dass Personifikationen eine unglaubliche Wirkung auf deine Business-Texte haben können? Wie man sie richtig einsetzt und was sie wirklich bringen, zeigen wir dir hier.

Anglizismen im Deutschen – so geht‘s
Sprache, TexttippFremdworte fuschen sich mittlerweile in unsere tägliche Sprache, ohne dass wir es bemerken. Und dabei werden sie gar nicht mehr ausschließlich von Jugendlichen verwendet, denn dank oder wegen der modernen Medien und der immer digitaleren Welt sind „denglische“ Begriffe in aller Munde. Wie wir in der deutschen Sprache korrekt mit (d)englischen Begriffen umgehen, erläutert dieser Blogartikel.