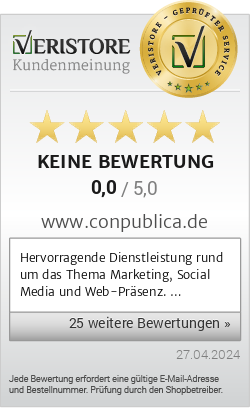Schlagwortarchiv für: Textertipp

Ein NEIN verwirrt! Warum wir lieber positiv schreiben sollten
Content, Sprache, TexttippWer positiv schreibt, wird besser verstanden und erreicht mehr Leser. Positiv formulierte Texte sind also ein wesentlicher Schritt zu guten Texten. Warum erklären wir.
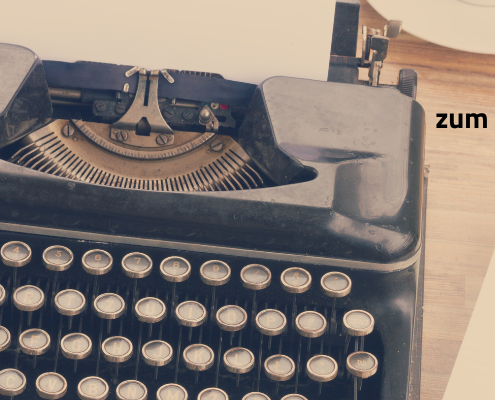
Mit ein paar Tipps zum perfekten Schreibstil
Content, Sprache, TexttippMaßgeblich für den Erfolg eines Textes ist, neben seinem Inhalt und seiner Verbreitungsform, die Art des Schreibstils. Für alle, die sich beim Formulieren schwertun, kommen hier Tipps, um Euren Schreibstil zu verbessern.

Die richtige Anrede für deine Webseite: Der ultimative Quick-Check
Content, Sprache, TexttippTexte für Webseiten zu schreiben ist eine unserer Hauptaufgaben. Eine Frage stellt sich dabei immer ganz zu Anfang: Soll auf der Webseite geduzt oder gesiezt werden? Wie man Kunden richtig anspricht, ist dabei eigentlich ganz leicht herauszufinden. Wir haben den ultimativen Quick-Check für euch!

Falsche Schreibweise – Richtige Schreibweise
Content, Sprache, TexttippWer uns auf den sozialen Medien folgt, hat sicherlich bereits bemerkt, dass wir seit einiger Zeit die typischen falschen Schreibweisen von Wörtern aufzeigen. Die deutsche Rechtschreibung hat es nämlich in sich und viele von uns schreiben täglich unwissentlich Worte falsch. Wir erklären dir, warum viele Menschen die Worte falsch schreiben und zeigen dir typische Beispiele.
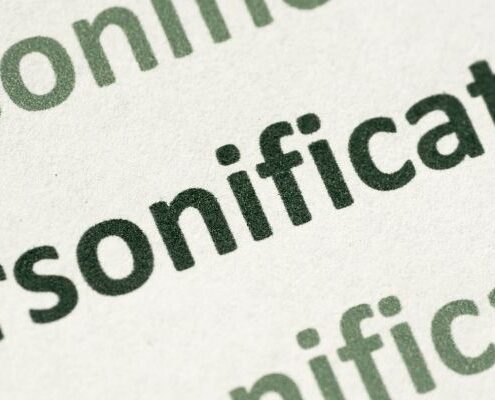
Vertraute Bilder – wie Personifikationen deinen Text zum Leben erwecken
Kreativität, Sprache, TexttippWer in der Schule mal Lyrik analysieren musste, kennt sie vielleicht noch: die Personifikation. Die „Vermenschlichung“ von Gegenständen, Tieren oder Pflanzen wird dort als Stilmittel häufig eingesetzt. Aber wusstest du auch, dass Personifikationen eine unglaubliche Wirkung auf deine Business-Texte haben können? Wie man sie richtig einsetzt und was sie wirklich bringen, zeigen wir dir hier.
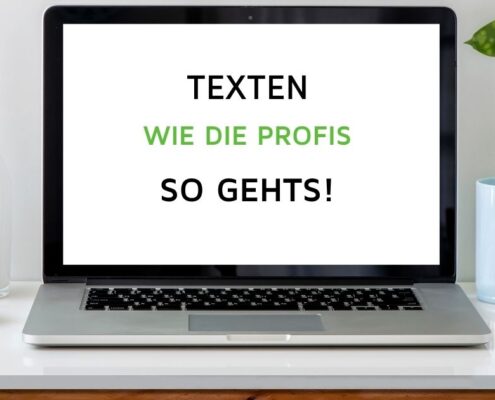
Texten wie die Profis – so gehts
Kreativität, Sprache, TexttippFormulieren müssen wir im Leben immer wieder, sowohl geschäftlich als auch privat. Egal ob Reden, Aufsätze, Dankesschreiben, Postings und Blogs oder Business-Texte: fesselnd zu schreiben ist nicht leicht. Profis haben dieses Problem auch, aber eine Trickkiste, mit der sie sich dann weiterhelfen. Wir öffnen sie für dich.

Wie schreibt man eigentlich gendergerecht?
PR-TIPPS, Sprache, TexttippEs wird immer mehr zum Thema: gendergerechtes Schreiben. Wer Stellenanzeigen verfasst, muss es genauso berücksichtigen wie alle, die offizielle Anschreiben texten. Aber auch in allen anderen Texten kommt man heute nicht mehr an der gendergerechten Sprache vorbei. Facebook bietet in Zukunft unter „Geschlecht/benutzerdefiniert“ immerhin die Möglichkeit, zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern zu wählen. Wie aber setzt man gendergerechtes Schreiben ohne großen Aufwand um? Wir haben ein paar Tipps für dich.

Das Textergeheimnis: 3 wirklich wirksame Überschriften, die jeder Blogger kennen sollte
Journalisten, PR-TIPPS, Sprache, TexttippHast du dich auch schon mal gefragt, was uns dazu bringt, bestimmte Texte zu lesen und andere nicht? Zuerst stoßen wir immer auf die Überschrift, ganz klar. Ist die nicht interessant genug, machen wir hier erst mal Schluss. Das wissen natürlich auch die Journalisten und Medien, weshalb oft sehr reißerische Headline veröffentlicht werden.
Doch welche Überschriften ziehen (fast) immer? Gibt es eine Wunderformel für Überschriften, die uns reizen, speziell bei Online-Medien, die man meist zwischen Tür und Angel konsumiert? Ja, die gibt es. Zumindest unserer Erfahrung nach.
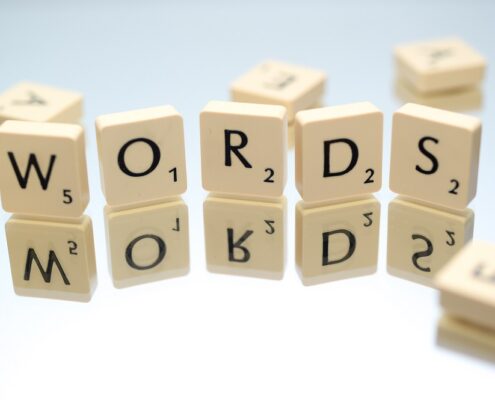
Doppel- und mehrdeutige Wörter sind ein Problem im Internetzeitalter
Onlinemarketing, Sprache, TexttippIm Deutschen gibt es so viele Worte, die zweierlei Bedeutung haben. Im heutigen Internetzeitalter bringen genau diese uns immer wieder zum Stolpern. Denn die Suchmaschine weiß nicht, ob mit Kette den Schmuck oder das Ding aus Stahl meinst. Wir müssen also lernen, solche Worte genauer zu beschreiben.

Über Deppenleerzeichen und Bandwurmwörter
Sprache, TexttippDu depperter Depp, Du! Diese Art der Beschimpfung, die wohl aus dem süddeutschen Sprachraum stammt, gilt jemandem, der nicht ganz richtig im Kopf oder ungeschickt ist. Ob der von uns in diesem Beitrag erklärte Begriff der „Deppenleerzeichen“ von dem besagten Depp abzuleiten ist, wissen wir nicht. In unserem aktuellen Blogbeitrag erklären wir aber, was es mit dem Begriff der „Deppenleerzeichen“ auf sich hat und warum du diese besser nicht nutzen solltest.