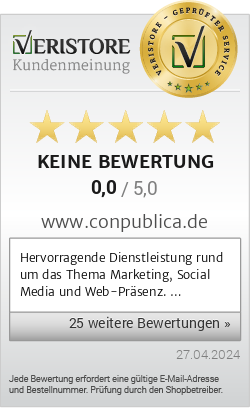So geht Texten: Optimieren, korrigieren, lektorieren
Content, PR-TIPPS, Sprache, TexttippOk – wir sind voreingenommen wie Deutschlehrer. Denn wir haben jeden Tag mit Texten zu tun. Wir schreiben, wir berichtigen, wir machen den Text besser, lesbarer, spannender. Deswegen sind uns schlechte oder fehlerhafte Texte immer ein Dorn…

Leichte Sprache – verständlich und damit barrierefrei
Content, TexttippHeute sind Informationen durch Websites, Apps und Co. allgegenwärtig. Das heißt jedoch nicht, dass sie für alle gleich zugänglich sind. Schon mal darüber nachgedacht, dass es nicht für jeden leicht ist, die Flut von Texten zu lesen und…

A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away – so kreativ kann deine Weihnachtspost sein
Content, Kreativität, Sprache, TexttippWeihnachten steht vor der Tür. Und was gibt es Schöneres, als mit einer extra Portion Kreativität und Herzlichkeit deine Weihnachtspost zu gestalten? In diesem Beitrag erfährst du, wie du mit originellen Formulierungen und Tricks die Herzen…

So schreibst du einen professionellen Fachartikel
Content, Journalisten, PR-Branche, PR-TIPPS, Sprache, TexttippEgal, ob du ein Laie, Experte, Journalist oder Webtexter bist, das Schreiben eines Fachartikels ist zwar aufwendig, aber keine Hexenkunst. Bevor du loslegst, solltest du dir jedoch über Formalien und Struktur im Klaren sein. Unser Tutorial…

10 Tipps für verständliche Unternehmens-Kommunikation
PR-Branche, Sprache, Strategie, Texttipp„Wir können nicht nicht kommunizieren.“ Das hat Paul Watzlawick so schlau in den 60er- Jahren bemerkt. Zwar war damit auch die Körpersprache gemeint, aber für Unternehmen gilt dieser Grundsatz ganz genauso. Jegliche Aktion – sei es…
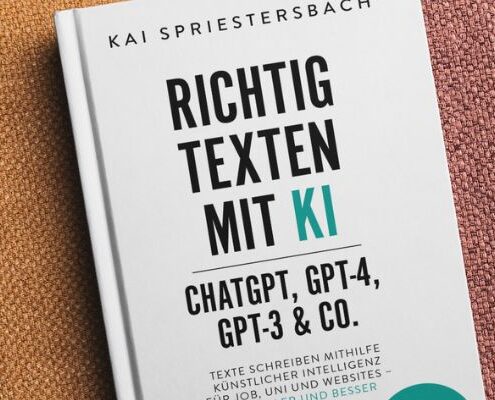
Buchvorstellung „Richtig texten mit KI“ von Kai Spriestersbach
Buchtipp, News, Sprache, TexttippKünstliche Intelligenz (KI) ist heutzutage allgegenwärtig und erobert verschiedene Anwendungsfelder mit erstaunlichen Fortschritten. Vor wenigen Jahren schien es undenkbar, dass ein Computer komplexe Texte oder Grafiken in bisher unerreichter…
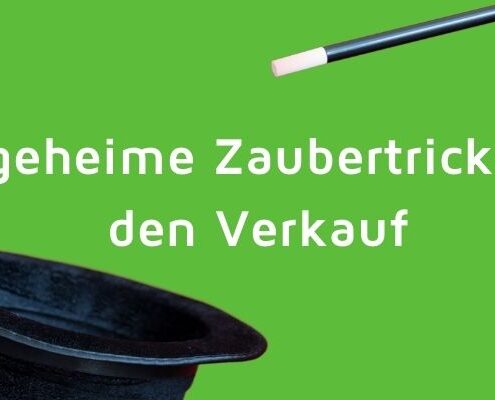
15 geheime Zaubertricks, die Interessenten wirklich zu Käufern machen
Content, Sprache, TexttippOb wir uns nur für ein Produkt interessieren oder es auch wirklich kaufen, hängt manchmal an einer Kleinigkeit. Oft entscheidet ein einzelnes Wort, ob wir zulangen. Die sogenannten „Zauberwörter“ für Texte, die gelesen werden“ haben wir dir bereits vorgestellt. Eben diese Zaubertricks gibt es auch für den Verkauf. Hier verraten wir dir 15 ultimative Tricks.
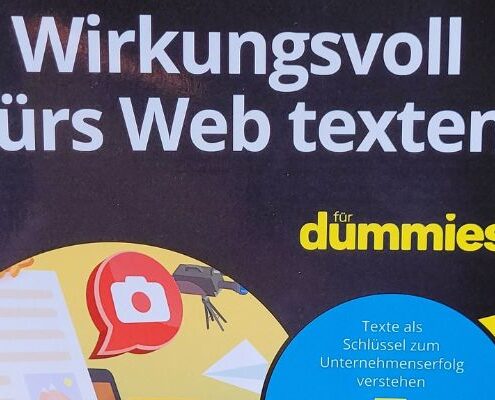
Buchtipp – „Wirkungsvoll fürs Web texten für Dummies“ von Gero Pflüger – ausführlich, praktisch, gut.
Buchtipp, Print, Sprache, TexttippDie „für Dummies-Buchreihe“ kennt fast jeder. Nicht umsonst zählt sie seit mehr als 30 Jahren zu den beliebtesten Ratgebern. „Wirkungsvoll fürs Web texten“ von Gero Pflüger reiht sich nun in die Riege der beliebten Alltagshelfer ein. Und das sehr gelungen, wie wir finden. Hier ist unsere vollständige Rezension.

Dos und Don´ts beim Texten fürs Web
Sprache, TexttippWir lieben einzigartige Webtexte. Sie zu schreiben, ist allerdings gar nicht so einfach. Denn Onlinetexte gehorchen anderen Regeln als Offlinetexte. Texte fürs Web müssen deswegen speziell dafür geschrieben werden. Hier kommen die Dos und Dont's.

Ein NEIN verwirrt! Warum wir lieber positiv schreiben sollten
Content, Sprache, TexttippWer positiv schreibt, wird besser verstanden und erreicht mehr Leser. Positiv formulierte Texte sind also ein wesentlicher Schritt zu guten Texten. Warum erklären wir.